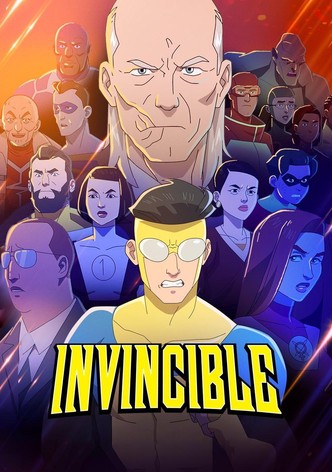Superhelden galten lange als moralische Leitfiguren – perfekte Figuren mit klaren Prinzipien. Doch Serien wie Gen V zeigen, wie weit sich das Genre davon entfernt hat. Statt edler Retter dominieren heute Narzissmus, Medienhysterie und Blut. Gen V führt das von The Boys geprägte Prinzip der Dekonstruktion fort: eine Welt, in der Macht per Algorithmus verteilt wird und Image alles ist.
Diese Entwicklung markiert den reifsten und radikalsten Moment des Superhelden-Fernsehens. Von der nihilistischen Gesellschaftskritik in Watchmen bis zur schmerzhaften Menschlichkeit in Doom Patrol – diese acht Serien beweisen, dass das Genre nur überlebt, wenn es sich selbst auseinandernimmt.
Gen V (2023)
Gen V verlegt das Universum von The Boys an die Godolkin University – eine Mischung aus Elitecampus, Realityshow und Waffenschmiede. Hier lernen junge Supes nicht Verantwortung, sondern Imagepflege. Die Serie kombiniert Teen-Drama mit abgründiger Satire und expliziter Gewalt. Hinter dem Blut steckt ein erstaunlich scharfer Kommentar über Ruhm, Leistungsdruck und mediale Selbstvermarktung. Gen V funktioniert als eigenständige Geschichte, ergänzt aber elegant das Mutter-Franchise. Für Fans von The Boys oder Peacemaker, die mehr über den Ursprung dieser kaputten Heldenwelt erfahren wollen, ist Gen V ein Pflichtprogramm – brutal, zynisch und verdammt treffsicher. Eine dritte Staffel wurde bislang nicht offiziell angekündigt, doch Showrunner Eric Kripke erklärte, dass bereits Pläne für Season 3 existieren.
The Boys (2019)
Die Serie, mit der alles begann. The Boys dekonstruiert das Superhelden-Genre bis zur bitteren Ironie: Hier sind Helden Markenprodukte, PR-geschützte Monster in Spandex. Gewalt und Zynismus sind keine Stilmittel, sondern Symptome einer durchkommerzialisierten Welt. Doch hinter dem Splatter steckt mehr als blanke Provokation – ein wütender, oft erschreckend ehrlicher Blick auf Machtmissbrauch, Fanatismus und Manipulation. Im Gegensatz zu Gen V wirkt The Boys erwachsener, politischer und nihilistischer, fast schon wie ein Spiegel unserer Gegenwart. Es ist der Referenzpunkt, an dem Serien wie Invincible oder Peacemaker gemessen werden. Nach dieser Serie glaubt niemand mehr, dass Superhelden noch etwas retten können – nicht einmal sich selbst.
Invincible (2021)
Was als klassischer Coming-of-Age-Comic beginnt, entpuppt sich als brutale Vater-Sohn-Tragödie über Erwartungen, Macht und Angst vor dem eigenen Erbe. Invincible nutzt Animation nicht zur Vereinfachung, sondern zur Eskalation: Kämpfe werden zu existenziellen Zusammenbrüchen, jedes Blutbad zum Spiegel familiärer Gewalt. Die Serie ist das emotionale Gegenstück zu The Boys: weniger zynisch, aber noch kompromissloser in ihrer Konsequenz. Gewalt dient hier nicht der Schau, sondern der tiefgreifenden Charakterentwicklung. Fans von Gen V oder Doom Patrol werden überrascht sein, wie viel psychologische Tiefe hinter der Comic-Optik steckt. Invincible zeigt, dass Reife im Genre vor allem dort entsteht, wo Helden an sich selbst zerbrechen.
Peacemaker (2022)
Peacemaker entwickelt die aus The Suicide Squad bekannte Figur weiter – derbe, laut, zugleich überraschend verletzlich. John Cena spielt den hyperloyalen Kämpfer als jemanden, der zwischen Schuld, Männlichkeitsbildern und Selbstbild schwankt. Seine Darstellung sitzt in jeder Nuance; in dieser Rolle wirkt er schlicht alternativlos. Die Serie verbindet groben Humor und Action mit Momenten echter Selbstreflexion. Gegenüber The Boys wirkt sie witziger, zugänglicher und stärker charakterzentriert; im Vergleich zu Doom Patrol weniger melancholisch, aber nicht banal. Zielgruppe: alle, die Antihelden mit Ecken und Kanten mögen und bei aller Härte auch Platz für Empathie wünschen. Kein Heiligenmythos, sondern eine bewusst unglamouröse Figurenskizze – mit Pop-Ader und klarer, pointierter Satire.
Doom Patrol (2019)
Doom Patrol konzentriert sich auf Außenseiter, deren Kräfte eng mit Trauma und Identität verknüpft sind. Statt einer klassischen Heldenreise setzt die Serie auf surreale, oft tragikomische Episoden, in denen Selbstsuche und Akzeptanz im Mittelpunkt stehen. Sie ist weniger zynisch als The Boys und weniger plappernd-ironisch als Peacemaker, aber ganz sicher nicht „leise“: Slapstick, groteske Bilder und abrupte Tonwechsel gehören dazu. Entscheidend ist, dass die Gewalt und das Absurde nicht zur Schau gestellt werden, sondern die inneren Brüche der Figuren spiegeln. Brendan Frasers Robotman steht exemplarisch für das Spannungsfeld aus Körper, Erinnerung und Selbstwert. Für Zuschauer:innen, die psychologisch gefärbte, ungewöhnliche Erzählweisen suchen, ist Doom Patrol eine perfekte Wahl – eigenwillig, berührend und oft bewusst chaotisch.
Watchmen (2019)
Damon Lindelofs Watchmen verlegt Motive des Comics in eine alternative Gegenwart der USA und verknüpft sie mit realer Gewaltgeschichte, darunter dem Massaker von Tulsa 1921. Das Ergebnis ist keine klassische Superhelden-Action, sondern ein politisch aufgeladener Diskurs über Erinnerung, Macht und Verantwortung in modernen Gesellschaften. Masken dienen hier als soziale Marker und als Spiegel kollektiver Verdrängung, nicht als Freifahrtschein für moralische Eindeutigkeit. Im Spektrum dieser Liste ist Watchmen die analytischste und konsequenteste Position: weniger Explosionen, mehr Meta-Ebene, präzise Figurenarbeit (etwa durch Regina King). Kurzum: Der perfekte Pick für alle, die das Genre als serielles Essay über Staat, Trauma und Identität begreifen.
The Punisher (2017)
The Punisher erzählt Vigilantismus mit klarem Fokus auf PTSD, Verlust und die lebenslangen Folgeschäden von Gewalt. Jon Bernthal zeichnet Frank Castle als Mann, der nicht in heroischen Gesten aufgeht, sondern mit der Leere nach dem Krieg und den Konsequenzen seines Handelns ringt. Die Inszenierung bleibt erdig und körperlich; die Action ist hart, aber nie ästhetisiert. Im Gegensatz zu Peacemaker fehlt die ironische sichtweise, im Gegensatz zu Invincible der Comic-Filter – genau das erzeugt eine ganz eigene Tonalität. Die Serie richtet sich an Zuschauer:innen, die eine dichte, ungeschönte Auseinandersetzung mit Rache suchen. Kein kathartischer Triumph, keine moralische Reinigung, sondern ein nüchterner Blick auf Gewalt ohne Romantisierung.
The Umbrella Academy (2019)
Hier stehen Familienstrukturen, Zeitreisen und persönliche Dysfunktion gleichberechtigt neben den unvermeidbaren Superkräften. The Umbrella Academy verbindet Pop-Energie und Melancholie, ohne in reinen Klamauk oder zynische Distanz zu kippen. Gewalt dient der Charakterentwicklung, nicht dem Spektakel. Im Vergleich zu Gen V rückt die Serie stärker Bindungen, Verluste und Verantwortung in den Vordergrund, statt Vermarktungsmechaniken auszuspielen. Für Zuschauer:innen, die Ensemble-Erzählungen mit klaren Figurenbögen mögen und ein weniger zynisches, aber erwachsenes Gegenangebot zu The Boys suchen. Ergebnis: ein zugänglicher, eigenwilliger Beitrag, der den Genre-Rahmen nutzt, um über Familie und Identität zu erzählen – ohne falsche Heldenpose.